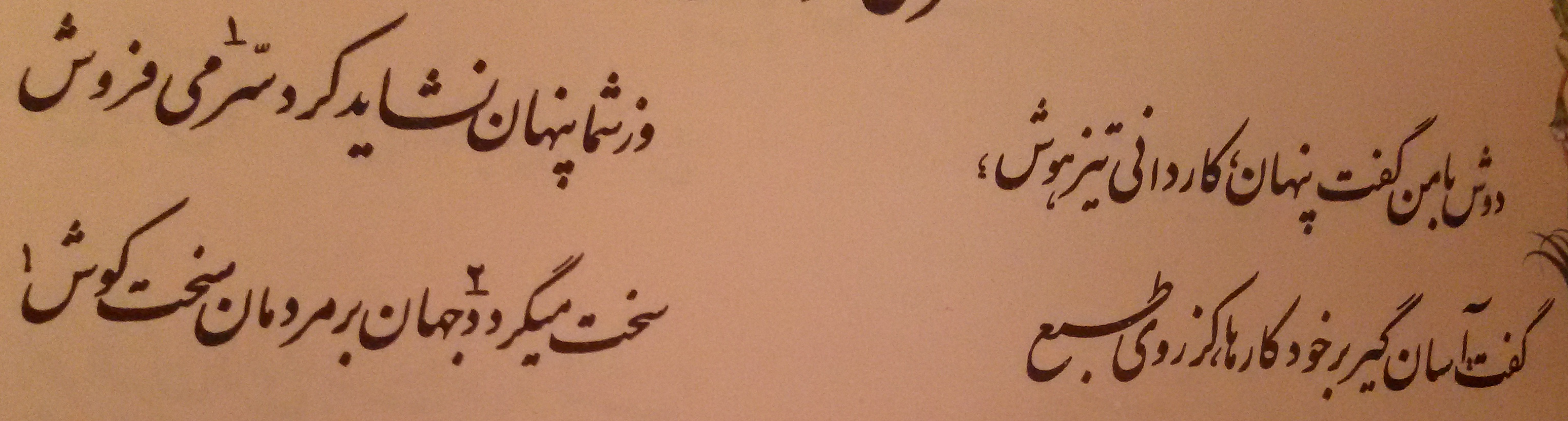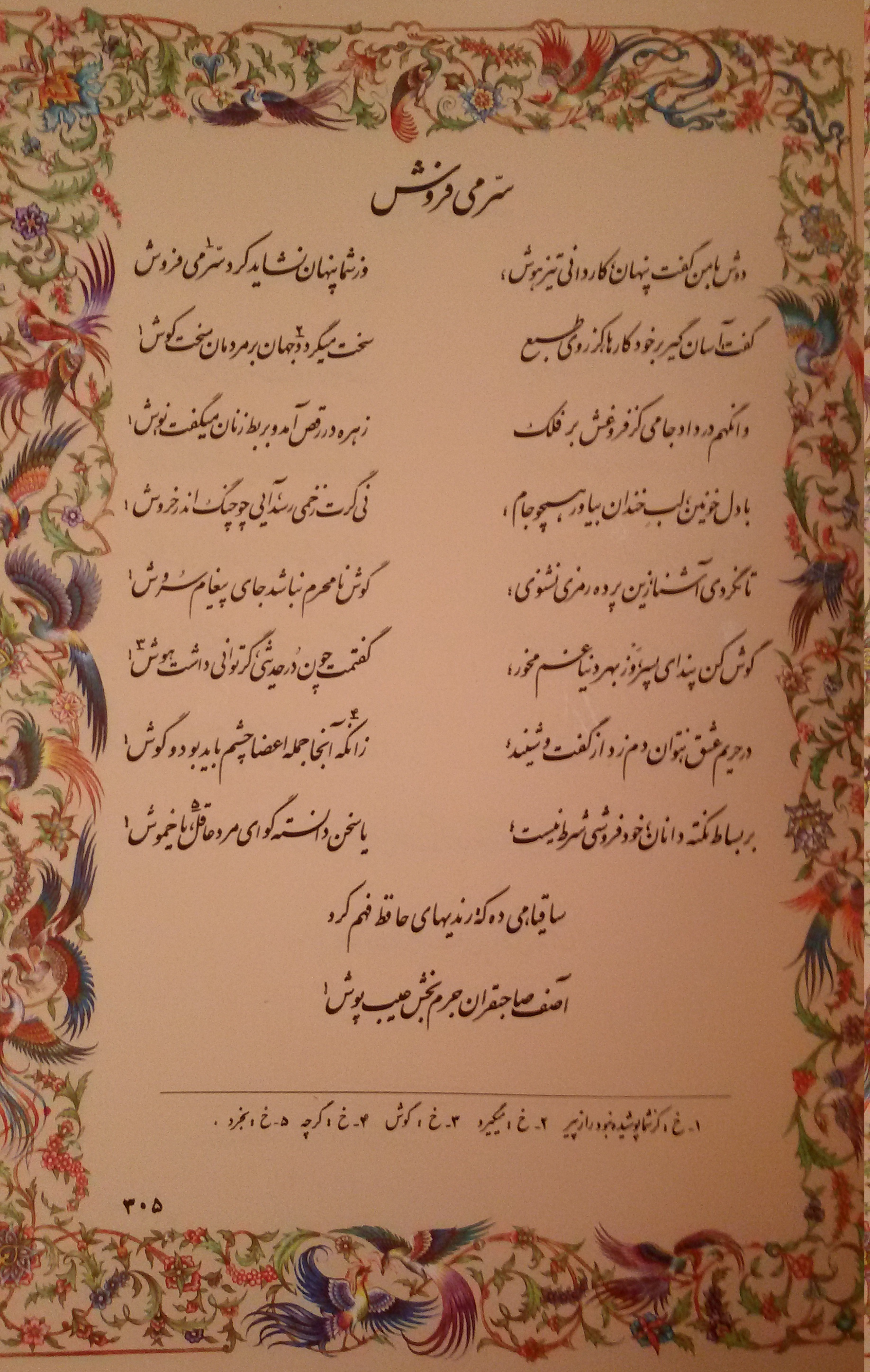Heute bekommen Sie einen exklusiven Bericht meiner Kollegin Kira Schmidt Stiedenroth aus ihrem aktuellen Arbeitsalltag in einem Flüchtlingsheim. Und nun gebe ich Kira das Wort:
Flüchtlinge kommen aus der ganzen Welt nach Deutschland, entsprechend bringen sie eine große Vielfalt an Sprachen, kulturellen Hintergründen und Religionen mit. Menschen fliehen nicht nur vor Krieg oder humanitären Katastrophen, auch politische Verfolgung und Gefahr für Leib und Leben sind rechtliche Gründe, um die Anerkennung des Flüchtlingsstatus nach den Genfer Konventionen zu erhalten.
Leider gibt es beinahe auf der ganzen Welt Menschen, die solchen Gefahren aus verschiedenen Gründen ausgesetzt sind. Gerade ethnische oder religiöse Minderheiten werden in manchen Ländern diskriminiert oder verfolgt, deshalb ist die religiöse und sprachliche Vielfalt unter Flüchtlingen extrem groß.
Durch meine Arbeit als Leiterin einer Flüchtlingsunterkunft habe ich festgestellt, dass sogar unter sehr engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern Unklarheiten vorhanden sind, was die Sprachen der Flüchtlinge angeht. So habe ich zum Beispiel einmal erlebt, wie eine freiwillige Helferin stolz ihren neu erworbenen arabischen Wortschatz bei afghanischen Bewohnern zu testen versuchte. Dies führte zunächst zu Verwirrung, anschließend brachte die komische Situation alle zum Lachen.
Obwohl die Herkunft der Flüchtlinge immer vielfältig war, scheint in letzter Zeit besonders das Interesse an der arabischen Sprache im Kontext der Flüchtlingshilfe gewachsen zu sein, was selbstverständlich an der großen Anzahl syrischer Schutzsuchender liegt. Aber der Gedanke, dass alle muslimischen Flüchtlinge Arabisch sprächen, ist genauso irreführend wie die Idee, dass alle Flüchtlinge aus arabisch-sprechenden Ländern Muslime seien.
Dies wird leider oft genauso angenommen, was zu Missverständnissen im Alltag der Flüchtlingsarbeit führt. Nicht alle Tritte ins Fettnäpfchen enden so glücklich wie in meinem Beispiel. Daher ist es wichtig, sich einen Überblick über Sprachen, Kulturen und Religionen der Menschen zu verschaffen, die wir in unserem Land willkommen heißen möchten.
In der Tat ist Arabisch zur Zeit wohl die meistgesprochene Sprache unter Flüchtlingen. Viele Menschen aus Ländern in Nordafrika und im Nahen Osten, wo Arabisch als Amtssprache gilt, haben Asylanträge gestellt. Die meisten davon kommen aus Syrien. 2016 wurde laut Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge die Mehrheit der Asylanträge von Syrern gestellt.
Irak, ein weiteres Land mit Arabisch als Amtssprache, steht auf Platz drei der Herkunftsländer der Antragsteller. Aber im Irak genießt neben Arabisch auch Kurdisch den Amtssprachen-Status. Kurdisch wird auch von einigen Syrern gesprochen sowie zum Teil von türkischen Flüchtlingen, die es neben Türkisch beherrschen.
Kurdisch mag für Persisch- und sogar für Urdu-Sprecher vertraut klingen: die indogermanische Sprache gehört zu der Unterfamilie der iranischen Sprachen. Es gibt durchaus Iraker, die gar kein Arabisch sprechen können, sondern nur Kurdisch. Wenn eine kurdischsprachige Bewohnerin zum Arzt muss und weder Deutsch noch Englisch spricht, muss ich einen Kurdisch-Dolmetscher für sie organisieren. Klingt ganz einfach. In der Praxis ist es aber etwas komplizierter…
Sprachen und Dialekte
Ein Lieblingsgesprächsthema der Deutschen – so habe ich festgestellt, als ich selbst hier Deutsch gelernt habe – sind die unterschiedlichen Dialekte, von Ostfriesisch bis Schwäbisch, von Sächsisch bis Bayerisch. Ein Dialekt wird als eine regionale Variation einer Sprache definiert, die sich – im Gegensatz zum Akzent – nicht nur in der Aussprache, sondern auch z.B. im Wortschatz oder in der Grammatik, unterscheidet.
Kurdisch hat ähnlich wie Deutsch verschiedene Dialekte. Die meisten Kurdisch-Sprecher beherrschen entweder Kurmandschi (oder Nordkurdisch) oder Sorani (Zentralkurdisch). Die Frage nach dem Dialekt ist hier entscheidend: anders als im Deutschen, wo zu erwarten wäre, dass ein Sachse sich mit einem Schwaben zumindest verständigen kann – auch wenn dies schwierig sein mag –, verstehen sich Kurdisch-Sprecher oft nicht untereinander, wenn sie unterschiedliche Dialekte sprechen.
Deshalb ist bei Kurdisch die Frage des Dialektes von großer praktischer Bedeutung, wenn es um die Bestellung von Kultur- und Sprachmittlern geht.
Neben Arabisch ist Persisch eine weitere wichtige Sprache der Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlinge in Deutschland. Die iranische Variante des Persischen wird auch Farsi genannt. Iraner bildeten letztes Jahr laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die viertgrößte Gruppe von Asylantragstellern. Auch Flüchtlinge aus Tadschikistan, Usbekistan und anderen zentralasiatischen Ländern sprechen z.T. Persisch.
Unter den Flüchtlingen sind die größte Gruppe der Persisch-Sprecher aber vermutlich die Afghanen: mit mehr als 125.000 Anträgen war Afghanistan das Land mit der zweitgrößten Gruppe von Asylantragstellern im Jahr 2016.
Viele Afghanen behaupten, Dari zu sprechen. Dari wird oft als die afghanische Variation des Persischen betrachtet, wobei Dari als regionale Bezeichnung für die gleiche Sprache gilt, nicht als eigenständiger Dialekt. Doch ich habe oft erlebt, dass Dari-Sprecher aus Afghanistan sich mit einem Farsi-Dolmetscher aus Iran nicht gut genug verständigen können, um einen Arztbesuch reibungslos durchzuführen.
Hier scheint das Bildungsniveau eine wichtige Rolle zu spielen: Hoch-Persisch wird in der Schule gelernt, aber nicht jeder hat die Schule besucht. Auch die eigene Biographie spielt eine wichtige Rolle: afghanische Flüchtlinge, die in Iran gelebt haben oder gar dort geboren wurden, haben logischerweise weniger Probleme, sich mit Iranern zu verständigen, auch wenn sie in der iranischen Gesellschaft nie integriert waren. (Anm. SK: Die Afghanen sind in Iran die „Gastarbeiter“.)
Die unterschiedlichen Dialekte werfen die interessante Frage nach den Grenzen zwischen Dialekt und eigenständiger Sprache auf. Eine Frage die nicht nur aus linguistischer, sondern auch aus politischer Sicht bedeutsam ist. Die Anerkennung und Legitimation von Sprachen und somit ethnischen Gruppen als eigenständige Einheiten hängt eng mit territorialen Ansprüchen und der Idee von Nationen zusammen.
Oft werden Sprachen aus politisch-taktischen Gründen abwertend als Dialekte bezeichnet. Im Umkehrschluss gibt es in der Geschichte Beispiele, wo Sprachvariationen aufgrund religiöser bzw. territorialer Trennung sich als voneinander abgetrennte, eigenständige Sprachen entwickelt haben: Hindi und Urdu sind hier Paradebeispiele.
Weitere bedeutende Sprachen der Flüchtlinge in Deutschland
Unter Afghanen wird nicht nur Farsi oder Dari gesprochen, sondern häufig auch Pashto. Zusätzlich beherrschen z.B. afghanische Hindus auch Hindi (auch die Schrift), Urdu (welches, dank Dari, auch gelesen werden kann) und sogar Panjabi: indische Sprachen, die auf die ursprüngliche Herkunft der Vorfahren hindeuten.
Es gibt auch nicht-Hindu Afghanen, die trotzdem Hindi oder Urdu sprechen oder zumindest verstehen. Das haben sie zum Teil den Massenmedien zu verdanken: filmophile Afghanen lernen Hindi (bzw. Urdu) durch Bollywood-Filme und indische Fernsehserien. Andere haben zuvor als Flüchtlinge in Pakistan gelebt und sich dort die Landessprache angeeignet.
Durch die Vielzahl von Asylantragstellern aus den Balkanländern finden wir die Sprachen der Region unter den meistgesprochenen in Flüchtlingsunterkünften. Asylantragsteller aus Albanien und Mazedonien können oft nebst Albanisch bzw. Mazedonisch auch Griechisch und sogar Türkisch, letztere eine Sprache die auch oft von Syrern und anderen Flüchtlingen, die lange Zeit in der Türkei verbracht haben, gesprochen wird. Auch Russisch ist eine wichtige Sprache.
Flüchtlinge aus Afrika vertreten eine große Anzahl von Sprachgemeinschaften. Menschen aus Nigeria sprechen i.d.R. neben einer der über 500 Sprachen des Landes (z.B. Hausa oder Yoruba) gut Englisch, die Amtssprache des Landes. Manche Nigerianer – besonders die aus dem nördlichen Teil des Landes – sprechen oder verstehen auch Arabisch. Flüchtlinge aus Guinea sprechen z.T. neben einer der mehr als 40 Sprachen des Landes auch die Amtssprache Französisch.
Südasiatische Flüchtlinge (zur Zeit meistens aus Bangladesch, Indien und Pakistan) sprechen je nach Herkunftsregion oft Balochi, Bengali, Hindi, Urdu, Paschto, Panjabi oder Tamil. Manche von ihnen beherrschen auch Englisch.
Dass viele Flüchtlinge aus afrikanischen oder südasiatischen Ländern neben ihren Muttersprachen auch Französisch bzw. Englisch sprechen hängt mit dem kolonialen Erbe zusammen, worin diese Sprachen zu Amtssprachen in diesen Ländern gemacht wurden.
Die hier genannten Sprachen zählen vielleicht zu den meistvertretenen Sprachen bei den Flüchtlingen, die zur Zeit in Deutschland sind. Diese Liste ist keinesfalls vollständig. Trotzdem können wir uns anhand dieser enormen sprachlichen Vielfalt vielleicht besser vorstellen, mit welchen Herausforderungen die Flüchtlinge untereinander, aber auch die Menschen, die mit Flüchtlingen arbeiten, täglich konfrontiert sind.
Deshalb ist das Erlernen von Deutsch extrem nützlich nicht nur nach der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder der Erteilung von subsidiärem Schutz, sondern direkt nach der Ankunft.
Die Vielfalt der Sprachen als Bereicherung
Viele Flüchtlinge – vielleicht sogar die meisten –, denen ich begegnet bin, würde ich als Sprachtalente bezeichnen. Sie sprechen i.d.R. mehr als nur eine Sprache, sei es weil sie zu einer Minderheit ihrer Herkunftsländer gehören, weil sie sich durch ihre Fluchterfahrung für längere Zeit in verschiedenen Ländern aufhalten mussten oder weil sie zu den Privilegierten zählen, die eine gute Schul- oder sogar höhere Bildung genießen konnten, bevor sie ihr Land verlassen mussten.
Viele haben mittlerweile sehr gut Deutsch gelernt und engagieren sich ehrenamtlich als Kultur- und Sprachmittler, um andere Flüchtlinge im Alltag zu unterstützen.
Seit neun Monate arbeite ich in einer Flüchtlingsunterkunft. In dieser Zeit konnte ich die sprachlichen Fortschritte vieler Bewohner verfolgen. Am beeindruckendsten finde ich immer die Geschwindigkeit, mit der Kinder sich die deutsche Sprache aneignen.
Zugegeben, es gibt auch wenig begabte Bewohner wenn es um das Deutschlernen geht. Vor allem ältere Menschen haben selbst nach langer Zeit im Lande Schwierigkeiten, sich auf Deutsch zu verständigen. Trotzdem bemühen sie sich oft um ein „Guten Tag“ oder bedanken sich auf Deutsch.
Nicht alle Flüchtlinge werden für immer in Deutschland bleiben. Sie werden eines Tages in ihre Heimat zurückkehren oder ihr Glück in einem anderen Land versuchen. Dorthin werden sie die deutsche Sprache mitnehmen und damit auch ein Stück deutsche Kultur. Und sie werden auch ihre eigene Sprache mit Deutsch bereichern, eine Entwicklung, die wir bereits beobachten können.
Neulich erzählte mir eine Kollegin, die selbst aus Marokko stammt und neben maghrebinischem Arabisch auch Hoch-Arabisch, Berberisch, Französisch, Englisch und Deutsch spricht, lachend, dass manche Bewohner in der von uns betreuten Unterkunft mittlerweile von “Ausweisāt” sprechen. Et voilà: ein arabischer Plural wird aus einem deutschen Wort gebildet. Deutsch wird „arabisiert“ oder besser gesagt: nicht Deutsch wird „arabisiert“, sondern Arabisch und auch andere Sprachen wie Persisch werden „deutschisiert“.
Denn “Ausweis” gehört – neben „Termin“, „Dolmetscher“, „Jobcenter“ und „Sozial“ (damit ist das Sozialamt gemeint) – mittlerweile zu den Standardwörtern, die in Beratungsgesprächen seitens der Unterkunftbewohner auftauchen, auch wenn ein Dolmetscher das Gespräch übersetzt. Sie scheinen bereits in ihre eigenen Sprachen integriert zu sein.
Somit hat Deutsch bereits seinen Weg ins Arabische, Persische und andere Sprachen gefunden. Wie Deutsch von der Vielfalt der Sprachen der Flüchtlinge beeinflusst und welche Konsequenzen dies haben wird, werden wir wahrscheinlich bald erfahren. Eine spannende Entwicklung, die nicht nur für Linguisten interessant ist.
Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016. Asylgeschäftsstatistik für den Monat November 2016. Online Verfügbar aus: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201611-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile (Zugang: 7. Januar 2016).
Bildnachweis
Beitragsbild: Weltkarte der Sprachfamilien
Quelle: Wikimedia Commons
Lizenz: Creative Commons 3.0
Urheber: Industrius
unverändert übernommen
Dr.des. Kira Schmidt Stiedenroth ist Ethnologin und hat bis April 2015 zusammen mit den Blogbetreiberinnen in einem DFG-Forschungsprojekt an der Ruhr-Universität Bochum gearbeitet. Zur Zeit leitet sie eine Flüchtlingsunterkunft.